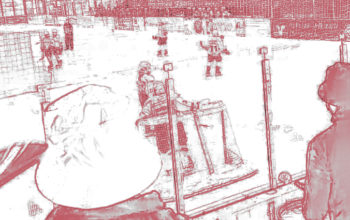“Nicht jeder Mensch kann in der Sprache, die er spricht, sein. Nicht etwa, weil er die Sprache nicht ausreichend beherrscht, sondern weil die Sprache nicht ausreicht.”
― Kübra Gümüşay, Sprache und Sein
Diese Erkenntnis bildet eine der Grundlagen der feministischen Sprachkritik. Eine ihrer Mitbegründer*innen, die Linguistin Luise Pusch, kritisiert, dass das generische Maskulinum, also die ausschließliche Verwendung der männlichen Form, Frauen immer nur ‚mitmeint‘, sie aber nicht direkt gemeint sind (vgl. Pusch 4).
Pusch vertritt die Ansicht, dass unsere Sprache somit dazu beiträgt, Unterdrückungsstrukturen aufrecht zu erhalten, weshalb sie sich aktiv für linguistische Veränderung einsetzt, die Frauen und Männer gleichermaßen repräsentiert. Erweitert wurde diese Forderung dann zudem um die sprachliche Berücksichtigung von Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen können oder wollen. Sie lässt sich aber auf alle Menschen übertragen, die Diskriminierung erfahren, welche auch sprachlich zum Ausdruck kommt. Auch wenn die Debatte um diversitätssensible Sprache von Diskussionen über das ‘Gendern’ geprägt ist, spielen auch andere identitätsstiftende Merkmale eine Rolle. Insbesondere die Verwendung von abwertenden Bezeichnungen oder Begriffen mit negativen Konnotationen bezogen auf die ethnische Zugehörigkeit, die soziale Herkunft, die Hautfarbe, die Religion, die sexuelle Orientierung, das Gewicht, körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, das Alter uvm. einer Person können Diskriminierungserfahrungen aktivieren und Stereotype fortschreiben. Umgekehrt kann ein diversitätssensibler und inklusiver Sprachgebrauch zu einer wertschätzenderen Ansprache und somit zur Gleichberechtigung beitragen.
Sprache und Macht
Um Gegner*innen der geschlechtergerechten und diversitätssensiblen Sprache zu überzeugen wird häufig an ihnen bekannte Denkmuster appelliert. So stoße ich immer wieder auf das Argument, dies sei im Sinne der Höflichkeit erforderlich. Es geht hier aber nicht um Höflichkeit. Gümüşay formuliert es in ihrem Buch so: „Menschen so zu bezeichnen, wie sie bezeichnet werden wollen, ist keine Frage von Höflichkeit, auch kein Symbol politischer Korrektheit oder einer progressiven Haltung – es ist einfach eine Frage des menschlichen Anstands” (53). Auch wenn ich die Überzeugung teile, Menschen sollten stets mit Respekt behandelt werden, geht die Debatte um geschlechtergerechte und diversitätssensible Sprache jedoch über die Kritik an bestimmten Sprachformen hinaus. Denn es geht um Machtstrukturen. Die feministische Psychoanalytikerin Luce Irigaray befasst sich vor allem mit der Darstellung des Weiblichen in den psychoanalytischen Theorien von Freud. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Frau in der symbolischen Ordnung des patriarchalen westlichen Wertesystems stets als Spiegelbild des Mannes fungiert (Irigaray 1980: 56–58). Diese symbolische Ordnung wird laut Irigaray unter anderem durch männliche Sprache aufrechterhalten (Irigaray 1979: 177). Demnach besitzen diejenigen, die andere bezeichnen nicht nur die diskursive Macht, sondern gleichzeitig auch die Deutungshoheit. Eine Sprache, die nicht die vom System definierte Realität wiedergibt, bleibt unverständlich und sinnlos. Sie kann den Machthabenden nichts anhaben, denn diese behalten die Macht zu definieren, was Sinn ergibt. Als unmündiger Teil des patriarchalen Systems muss die Frau daher, wie Irigaray vorschlägt, „die Funktionsweise des Diskurses […] ‚destruieren‘“ (Irigaray 1979: 78), um sich zu ermächtigen. Während die Bezeichnung oder eben auch nicht-Bezeichnung von Personen zu deren Unterdrückung beiträgt und somit bestehende Machtstrukturen aufrechterhält, fungiert dabei die Selbstbezeichnung als Mittel des Widerstandes. Durch die aktive Veränderung der Sprache, werden die zuvor unsichtbar gemachten Personengruppen plötzlich sichtbar. Vielmehr noch können sie so diskursive Macht einfordern (vgl. Butler “Critically Queer” 17).
Sprache und Verbote
Aus der damit einhergehenden Kritik an den bestehenden Machtverhältnissen, ergibt sich aber auch die Vehemenz, mit der viele Menschen darauf bestehen, Minderheiten weiterhin sprachlich diskriminieren zu können. Die Annahme, bei Nicht-Verwenden einer geschlechtergerechten Sprache abgestraft zu werden, ist dabei eine gefährliche Taktik, um die eigenen Machtansprüche zu bewahren. Immer wieder wird Kritiker*innen der geschlechtergerechten und diversitätssensiblen Sprache auf verschiedenen Plattformen eine große Bühne geboten, während sie sich als Opfer einer angeblichen Meinungsdiktatur oder Cancel Culture inszenieren. Ihre Rede von Einschüchterung, Bestrafung oder gar Diskriminierung ist ein klassischer Fall von Täter-Opfer-Umkehr. Denn das Bedürfnis nach angemessener sprachlicher Berücksichtigung als Verbot wahrzunehmen, untergräbt das gesellschaftliche Machgefälle, indem eigentlich privilegierte Gruppen in der Rolle der Unterdrückten wahrgenommen werden. Neben dem Vorwurf eine Verbotskultur oder Cancel Culture zu etablieren, wird auch immer wieder die Form des Protestes oder der Kritik in Frage gestellt (tone policing) oder von der Diskriminierung bestimmter Gruppen abgelenkt, indem andere Beispiele von Gewalt oder Unterdrückung ins Feld geführt werden (whataboutism). Dies alles sind Strategien der Diskursverschiebung, die den Machterhalt im patriarchalen System stützen, die eine konstruktive Debatte über die eigentlichen Missstände und tatsächlich stattfindende Diskriminierung von Frauen, inter, trans*, und nicht-binären Personen verhindert.
Zudem wird immer wieder darauf verwiesen (z.B. vom rechtspopulistischen Verein Deutsche Sprache), dass laut Umfrageergebnissen die Mehrheit der Deutschen gegen die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache sei (vgl. z.B. ZDF-Politbarometer von 2021, Zeit Online). Allerdings ist dieses Argument doch ziemlich kritisch zu bewerten, da hiermit sämtlicher Minderheitenschutz und Antidiskriminierungsarbeit mundtot gemacht würde. Wenn die Rechte von Minderheiten immer erst durch eine Mehrheit in der Dominanzgesellschaft durchgesetzt werden könnten, würde das im Umkehrschluss doch bedeuten, dass Minderheiten weiterhin diskriminiert werden können, weil die Mehrheit dafür ist und davon profitiert.
Sprache und Teilhabe
Abgesehen davon, dass die befürchteten zu erwartenden Konsequenzen für’s „Nicht-Gendern“ (oder eher anders Gendern, denn auch das generische Maskulinum ist eine Form des Genderns), in keiner Weise der Realität entsprechen, erscheint es doch seltsam rückständig, warum es manche Menschen so sehr kränkt, dass sie nicht weiter ungeniert diskriminieren dürfen. Die von Betroffenen geäußerte Form der Sprachkritik und der Wunsch nach Repräsentation hingegen verweisen auf eine Demokratisierung von Sprachentwicklung bzw. der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die mehr Menschen denn je politische und soziale Teilhabe ermöglichen würde. Und hier kommen wir zum eigentlichen Kern des Problems: Die angeblichen Verteidiger*innen der deutschen Sprache und der Meinungsfreiheit verwechseln den Abbau von Privilegien mit Diskriminierung. Sie möchten schlicht ihren Anspruch auf Deutungshoheit nicht abgeben. Und ist es da nicht verständlich, nicht mehr auf die Höflichkeit und das Entgegenkommen der anderen Seite zu warten, sondern den (sprachlichen) Wandel aktiv einzufordern?
Über die Autorin: Anna Carolin Müller ist promovierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und arbeitet als Referentin für Diversity Policies an der Goethe Universität Frankfurt. Neben ihren Arbeitsschwerpunkten, die in den Bereichen intersektionaler Feminismus und gendergerechte und diversitätssensible Sprach- und Bildgestaltung und Lehre liegen, forschte und lehrte sie im Bereich der Gender und Queer Studies unter anderem zu Darstellungsweisen von Geschlecht und der populärkulturellen Vermarktbarkeit von Diversität.
Butler, Judith. “Critically Queer.” GLQ A Journal of Lesbian and Gay Studies Vol. 1 (1993): 17-32.
Gümüşay, Kübra. (2020). Sprache und Sein. Berlin: Hanser.
Irigaray, Luce (1979 [1977]). Das Geschlecht, das nicht eins ist. Berlin: Merve Verlag.
Irigaray, Luce (1980 [1974]). Speculum: Spiegel des anderen Geschlechts. Frankfurt: Suhrkamp.
k. A. „Mehrheit der Deutschen lehnt gendergerechte Sprache.“ Zeit Online, 23. Mai 2021. Zugriff am 05.02.2023 unter https://www.zeit.de/news/2021-05/23/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gendergerechte-sprache-ab?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
Pusch, Luise F. „Totale Feminisierung: Überlegungen zum umfassenden Feminimum“. Frau ohne Herz: feministische Lesbenzeitschrift. Vol. 23 (1987): 4–10.