Der Text von Katalin Cseh-Varga mit dem Titel „Die Kritik der Kamera. Performative Fotografie im Ungarn der Siebzigerjahre“ bildet die Grundlage dieses Essays. Er ist 2019 in Adam Cziraks Werk „Aktionskunst jenseits des Eisernen Vorhangs“ erschienen.[i] Cziraks sammelte für sein Buch Texte, die sich insgesamt mit verschiedenen Formen von künstlerischer Kritik in Zeiten politischer Unterdrückung von Osteuropäer*innen beschäftigen. Das Kapitel von Cseh-Varga handelt von der performativen Fotografie als Mittel zur Kritikausübung, wobei der Fokus auch auf der Diversität der Kritik liegt. Um dies zu verdeutlichen arbeitet sie mit zwei Beispielen: Zum einen beschreibt die Autorin die Fotoserie von László Lakner und dem Fotografen György Gardányi, welche einen ungarischen Arbeiter der Siebzigerjahre in unterschiedlichen Phasen seines Alltages darstellt. Zum anderen beleuchtet sie bestimmte Fotoarbeiten des Künstlers Ákos Birkás.[ii] Anhand dieses Grundlagentextes möchte ich in diesem Essay die Gedanken zur Fotografie als sich auf Diversität berufende Kritikform weiter zuspitzen.
Performative Fotografie wird in Cseh-Vargas Text als eine besondere Kunstform hervorgehoben, basierend auf dem Funktionswandel der Kamera[iii], die sich nicht direkt zu einer Gattung zuordnen ließ. Neoavandgardist*innen hielten sich, wie es für diese charakteristisch war, nicht an vorgegebene Genregrenzen, auch wenn diese sich teilweise sehr an die Konzeptkunst anlehnten.[iv] Die Besonderheit ist, dass hier nicht nur das daraus entstehende Foto das Kunstwerk bildet, sondern auch der Prozess, der zu diesem Foto führt.[v] Das Geschehen um der Kamera erlangt dementsprechend Bedeutung. Ein Beispiel, auf dessen Interpretationsmöglichkeit ich im Verlauf noch näher eingehen werde, ist ein Foto von László Lakner. Dieser betrat, wie es für den performativen Charakter der Kunstform bedeutend war, die Bildfläche und zeigte dem Schauspieler, der einen Arbeiter darstellt, wie dieser eine Fahne zu halten hat. Eben diese Aktion des Zeigens wurde mit einem Foto festgehalten. Um zu verstehen, warum es zu solch einer Entwicklung in der Kunstgeschichte kam und vielleicht auch kommen musste, sollte man ebenfalls den Kontext betrachten.
Im Ungarn der Siebzigerjahre herrschte eine totalitär handelnde Regierung, welche verlangte, dass die Bevölkerung diese, vor allem auch öffentlich, unterstützt und gutheißt. Dazu gehörte, dass verschiedene Lebensbereiche auf eine gewisse Weise politisiert wurden und somit auch die Kunst. Diese strenge Sichtweise führte zu Kontrollen durch die Behörden, auch wenn es durch die Lockerungen im Kádár-Regime reichte, wenn Kunstwerke politisch neutral waren. Daraufhin fühlten sich die Neoavandgardist*innen gezwungen, nach neuen Möglichkeiten, den „[…] nicht zu kontrollierenden Nischen […]“[vi], zu suchen, um weiterhin Kritik am Regimen auszuüben.[vii] Dafür war die bildende Kunst im traditionellen Sinne nicht mehr geeignet und es wurde sich immer mehr an die Konzeptkunst gewandt, aber auch an ephemere Kunstarten. So konnte Kritik vermutlich im Nachhinein nicht mehr so gut nachverfolgt werden. Dazu gehörten zum Beispiel auch die performativen Aspekte der Kunst hinter der Kamera, welche primär und teils auch ausschließlich vor Ort zu bestaunen war.[viii] Cseh-Varga betont, dass Kunstwerke dieser neoavantgardistischen Art von vornherein „[…] als regimekritisch eingestuft […]“[ix] wurden, auch wenn jene oftmals einen vernachlässigbaren politischen Gehalt hatten. Ein Zusammenhang kann dadurch bestehen, dass diese Unkontrollierbarkeit, die auch mit der Ephemeralität einhergeht, zur Verunsicherung seitens der Regierung führt. Am Ende geht sie noch einmal indirekt auf diesen Aspekt ein, indem sie schreibt: „Aber liefert nicht gerade diese abstreitende Haltung, dieser Gestus der Verweigerung einen Hinweis darauf, in welchem Rahmen Kritik hier überhaupt möglich war?“[x]. Da sie auf diesen Punkt im Verlauf des Textes nicht weiter eingeht, ist nicht ganz deutlich geworden, was sie explizit meint. Allerdings liegt die Interpretation nahe, dass auch Kunstwerke, die keinen politischen Gegenstand haben, eben dadurch Kritik am Regime ausüben, da sie sich gegen das Gebot stellen, das politische System unentwegt zu unterstützen und anzupreisen. Um diese Kritik darzulegen, war es jedoch notwendig, dass dies nicht offensichtlich geschah, wodurch Kritik, um auf Cseh-Vargas unbeantwortete Frage zu antworten, nur möglich war, wenn es nicht den Anschein hatte.
Die Autorin hebt in ihrem Text eine Besonderheit der performativen Fotografie hervor, denn diese ermögliche eine „[…] doppelte Kritik […]“[xi], sowohl am Medium selbst als auch am Ereignis, welches durch das Kunstwerk dargestellt wird.[xii] Als Beispiel folgt der ungarische Maler László Lakner, jedoch geht sie nicht näher darauf ein, inwiefern er beide Arten der Kritik in einem Kunstwerk darstellt. Vielmehr scheint es so, als würde Lakner doch primär das Ereignis kritisieren. Dieser betonte schließlich die nicht wahrgewordene Umsetzung der Utopie des Sozialismus[xiii] dadurch, dass er die „[…] sozialistisch-realistische Ikonographie […]“[xiv] auf eine Art ironisiere. Anzuführen wäre hier das bereits in der Einleitung genannte Beispiel. Durch die ironische Aktion der Anweisung, wie der Arbeiter die Fahne zu halten hat, legt er den Fokus eher auf die Kritik an der Politik als auf die Schaffung des Kunstwerkes.
Dieses wird hingegen in den Arbeiten Ákos Birkás zum primären Thema. Der Maler übte durch einige seiner Werke nämlich vorwiegend Kritik an der Institution Kunst sowie dem/der Künstler*in und den Betrachtenden, wie zum Beispiel den Museumsbesucher*innen.[xv] Er kritisierte indirekt wie auch direkt, künstlerische Ausdrucksformen. Indirekt durch seine persönliche Entscheidung, mehr die Fotografie als Medium zu nutzen und direkt, da er sich in seinen Kunstwerken auf eine ironische Weise als Maler portraitiert.[xvi] Des Weiteren kritisiert Birkás „[…] den Kunstschaffenden als Ikone“[xvii], welcher selbst beeinflussen kann, wie er gesehen werden will, sowie die Betrachtenden, welche von ihm als Teil des Kunstwerkes dargestellt werden. Hierzu macht er den Betrachtenden direkt zum Teil des Kunstwerkes, indem seine Arbeit zum Beispiel ein Foto eines tatsächlichen Museumsbesuchers ist, wie jene mit dem Titel „Bild und Betrachter“.[xviii] Diese Kritik an der Kunst kann, wie schon zu Beginn erwähnt, ebenfalls als eine Kritik an den politischen und kulturellen Verhältnissen im Ungarn der Siebzigerjahre interpretiert werden, da sich Birkás Kunstwerke gerade einer offensichtlicheren und damit leicht kontrollierbaren Aussage entzogen und von der Regierung nur schwer als Sprachrohr instrumentalisiert werden konnte.[xix]
Dies zeigt also, dass scheinbar eher Birkás als Lakner doppelte Kritik in seiner Arbeit ausübt, da seine Kritik an diversen Punkten ansetzt und er sich beispielsweise nicht nur auf die Kritik an der Politik konzentriert. Möglich gemacht wird dies durch die Vielfältigkeit und die Freiheit der Kreativität, welche die performative Fotografie den Kunstschaffenden bietet.
Eine wichtige Kernaussage Cseh-Vargas ist, dass ein Medium genutzt werden kann, um Kritik mit unterschiedlichem Inhalt auszudrücken. Obwohl es von der Autorin nicht direkt thematisiert wird, ist Kritik dabei eine Art ‚Universalmethode‘. Dies wird durch die von ihr gewählten Beispiele besonders deutlich. Während Birkás in erster Linie die Kunst mit künstlerischen Mitteln kritisiert (immanente Kritik) und sich dabei dem staatlichen Zugriff entzieht, nutzt Lakner die Fotografie um in die politischen Verhältnisse jenseits der Kunst zu intervenieren (transzendente Kritik). Beide eint dabei die unscheinbare Weise, mit der sie Kritik üben.
Dies wird zum Beispiel durch die performativen Aspekte der Fotografie in Lakners Werken deutlich, aber gerade auch in Birkás Arbeiten können weitere als die womöglich primär intendierten Aussagen, als Kritik identifiziert werden. Dies hängt auch immer damit zusammen, aus welcher Perspektive man auf das Kunstwerk schaut. Ein Aspekt, auf den Cseh-Varga gar nicht in ihrem Text eingeht. Wenn man nach Kritik auf einer bestimmten Ebene sucht, findet man sie meistens auch. Dies wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich unterschiedliche Kommunikationsmodelle anschaut, wie beispielsweise das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Überträgt man das Kommunikationsquadrat als ein Rezeptionsmodell auf die bildenden Künste, so kann man schlussfolgern, dass es auch immer auf die Betrachtenden ankommt. Häufig lässt sich neben ausgestellten Kunstwerken keine Erläuterung vorfinden, denn, wie es gerade auch Birkás betont, lebt das Kunstwerk von den Betrachtenden, da es von diesen zu einem gemacht wird.
Cseh-Varga stellt die performative Fotografie im Ungarn der Siebzigerjahre als eine Form der Kritik vielfältiger Arten und Weisen dar und bettet ihre Untersuchung in den historischen Kontext ein. Allerdings wäre es, um Kritik an sich zu beurteilen, wichtig noch weiter zu denken und Kritik als Methode auch losgelöster von der Kunst zu betrachten. Kritik wird von jedem Menschen auf irgendeine Weise geäußert: Bewusst und unbewusst, offen und latent. Die Kritik, die sich in der Kunst wiederfinden lässt, zeigt dies besonders gut. Künstler*innen können sich bewusst dazu entscheiden Kritik am politischen System zu äußern, oder die Kritik geschieht unbewusst und wird erst durch die Betrachtenden interpretiert. Die Kritik kann durch das Kunstwerk offen, wie es häufig in der modernen Kunst der Fall ist, oder latent, wie in den Kunstwerken Lakners, erfolgen. Weitere, bis zum Ende ungeklärte Fragen schließen hieran an: Warum ist es wichtig, wie radikal oder intensiv die Kritik in einem Kunstwerk ausgeübt wird und wer darf das Maß an Kritik beurteilen?[xx] Gibt es eine Intensität künstlerischer Kritik, die ein Übersehen des Kritischen verunmöglicht?
Insbesondere dem Abschluss des Beitrags von Cseh-Varga stimme ich zu, nach welchem wir durch die genannten Kunstwerke und die ihnen innewohnende Kritik, viel über die damalige Zeit lernen können – nicht nur bezüglich der Kunstgeschichte.
Dieser Beitrag wurde von der Studentin K. Eilers verfasst. Er entstand im Wintersemester 2019/20 im Rahmen des Seminars „Bloß Kritik? – Diskussionen zur ‚Universalmethode‘ für Forschung und Gesellschaft“ von Frederik Metje an der Leuphana Universität Lüneburg.
[i] Vgl. Cseh-Varga, Katalin (2019): „Die Kritik der Kamera. Performative Fotographie im Ungarn der Siebzigerjahre“, in: Czirak, Adam (Hrsg.): Aktionskunst jenseits des Eisernen Vorhangs, Bielefeld, S. 183-200.
[ii] Vgl. ebd., S. 186.
[iii] Vgl. ebd., S. 183.
[iv] Vgl. ebd., S. 185f.
[v] Vgl. ebd., S. 184.
[vi] Ebd., S. 188.
[vii] Vgl. ebd., S. 187f.
[viii] Vgl. ebd., S. 183f.
[ix] Ebd., S. 188.
[x] Ebd., S. 199.
[xi] Vgl. ebd., S. 185.
[xii] Vgl. ebd.
[xiii] Ebd., S. 194.
[xiv] Ebd., S. 193.
[xv] Vgl. ebd. S. 195f.
[xvi] Vgl. ebd., S.196.
[xvii] Ebd., S. 197f.
[xviii] Vgl. ebd., S. 199.
[xix] Vgl. ebd., S. 194.
[xx] Vgl. ebd., S. 196.




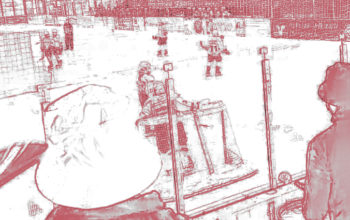
One thought on “Performative Fotografie – Wie die Kunst der Zensur entkam”
Comments are closed.